
Im Bestreben, die Situation im Binnenmarkt auch für die sogenannten freien Berufe zu verbessern, stehen die gesetzlichen wie quasi-gesetzlichen Vergütungsregelungen der freien, kammerorganisierten Berufe im Fokus der EU-Kommission. Die entsprechenden Vergütungs- und Honorarordnungen erschweren aus Sicht der EU den freien Preiswettbewerb bzw. verhindern ihn gänzlich.
Dieser grundsätzlichen Linie folgend hat die EU-Kommission die Bundesrepublik im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens anlässlich der Regelungen und Vorgaben der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) verklagt. Das nunmehr vorliegende Urteil des EuGH (04. Juli 2019; C-377/17) überrascht nicht: Die HOAI verstößt nach Ansicht der Richter sowohl gegen die EU-Dienstleistungsrichtlinie, als auch gegen die Niederlassungsfreiheit gem. Art. 49 AEUV.
Die Bedeutung des Urteils ist für die an einem Bau beteiligten Parteien erheblich:
Architekten werden einem schärferen Wettbewerb ausgesetzt werden, da Preiswettbewerbe zukünftig möglich sind bzw. aus Sicht der Kommission sogar gewünscht. Bislang verhinderte die seit 1977 geltende HOAI dies durch die Vorgabe von im Kern festen Honoraren.
Für Bauherren wird die Möglichkeit eröffnet, Preisverhandlungen nunmehr nicht nur mit den eigentlichen Baufirmen, sondern auch mit den Architekten zu führen.
Zum Kern des Urteils
Die Bundesrepublik verteidigte die Honorarordnung damit, dass die Vorgabe von Honoraren durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses im Sinne von Art. 15 der Dienstleistungsrichtlinie gerechtfertigt sei. Mit den Mindestpreisen sollten die Ziele der Qualität der Planungsleistungen, des Verbraucherschutzes, der Bausicherheit, des Erhalts der Baukultur und des ökologischen Bauens erreicht werden. Die Höchstpreise sollten den Verbraucherschutz sicherstellen, indem sie die Transparenz der Honorare im Hinblick auf die entsprechenden Leistungen gewährleisteten und überhöhte Honorare unterbänden.
Ausgehend von diesen aus Sicht des Europarechts legitimen Zielen hat der EuGH geprüft, ob die HOAI zur Erreichung dieser Ziele geeignet und erforderlich ist.
Im Hinblick auf die Eignung hat die Bundesrepublik aus Sicht des EuGH zunächst ausreichend begründet, dass die Erbringer von Planungsleistungen im Bauwesen in einem Konkurrenzkampf stünden, der zu Billigangeboten und durch „adverse Selektion“ sogar zur Ausschaltung von Qualitätsleistungen der anbietenden Wirtschaftsteilnehmer führen könne. Insofern könne die Festsetzung von Mindestpreisen dazu beizutragen, diese Gefahr zu begrenzen. Denn letztlich werde dadurch verhindert, dass Leistungen zu Preisen angeboten werden, die langfristig nicht die Qualität dieser Leistungen gewährleisten können.
Neben dieser grundsätzlichen Eignung forderte der EuGH – wie in anderen Entscheidungen – zusätzlich, dass die Erreichung des angestrebten Ziels in kohärenter und systematischer Weise erfolgen müsse.
Hier warf der EuGH der Bundesrepublik vor, sich – vereinfacht formuliert – unlogisch zu verhalten. Die Bundesrepublik habe selbst eingeräumt, dass die Erbringung von Planungsleistungen in Deutschland nicht Personen vorbehalten sei, die eine reglementierte Tätigkeit ausübten. Auch wenn diese nicht explizit benannt wurden, lässt sich hier beispielsweise an Bauträger und Generalplaner denken, die als Unternehmen ebenfalls Bauten planen. Es gebe somit jedenfalls keine Garantie, dass die Planungsleistungen von Dienstleistungserbringern erbracht würden, die ihre entsprechende fachliche Eignung nachgewiesen hätten.
Dieser Umstand lässt aus Sicht des EuGH im Hinblick auf das mit den Mindestsätzen verfolgte Ziel, eine hohe Qualität der Planungsleistungen zu erhalten, eine Inkohärenz in der deutschen Regelung erkennen. Es sei nämlich festzustellen, dass solche Mindestsätze nicht geeignet sein können, ein solches Ziel zu erreichen, wenn – wie aus den beim Gerichtshof eingereichten Unterlagen hervorgeht – für die Vornahme der Leistungen, die diesen Mindestsätzen unterliegen, nicht selbst Mindestgarantien gelten, die die Qualität dieser Leistungen gewährleisten.
Der Bundesrepublik Deutschland sei somit insgesamt der Nachweis nicht gelungen, wonach die in der HOAI vorgesehenen Mindestsätze geeignet sind, die Erreichung des Ziels einer hohen Qualität der Planungsleistungen zu gewährleisten und den Verbraucherschutz sicherzustellen.
Demgegenüber könnten die Höchstsätze – wie die Bundesrepublik Deutschland geltend macht – zum Verbraucherschutz beitragen, indem die Transparenz der von den Dienstleistungserbringern angebotenen Preise erhöht wird und diese daran gehindert werden, überhöhte Honorare zu fordern.
Jedoch hat die Bundesrepublik Deutschland auch diesbezüglich nicht begründet, weshalb die von der Kommission als weniger einschneidend vorgeschlagene Maßnahme, Kunden Preisorientierungen für die verschiedenen von der HOAI genannten Kategorien von Leistungen zur Verfügung zu stellen, nicht ausreichen würde, um dieses Ziel in angemessener Weise zu erreichen. Folglich könne das Erfordernis, Höchstsätze festzulegen, im Hinblick auf dieses Ziel nicht als verhältnismäßig angesehen werden.
Was aus dem Urteil (nicht) folgt
Herauszustellen ist, dass das Urteil zunächst „nur“ den Vergütungsrahmen gem. § 7 Abs. 1, 3 und 4 HOAI betrifft. Aus dem Urteil kann daher nicht gefolgert werden, dass die HOAI in Gänze europarechtswidrig ist.
Für laufende Streitigkeiten von Honorarforderungen dürfte davon auszugehen sein, dass das Einklagen von Mindestsätzen aufgrund dieses Urteils erschwert wird. Es ist gut vertretbar, dass die entsprechenden Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie aufgrund ihrer verbraucherschützenden Wirkung direkt gelten (sog. direkte Richtlinienwirkung). Dementsprechend könnten sich Bauherren mit Aussicht auf Erfolg auf den Wegefall der Mindestpreisgrenze gem. HOAI berufen.
Preisbildung im Vergabeverfahren
Damit bleibt die Frage, welche Folgen das Urteil auf zeitnah durchzuführende Vergabeverfahren hat? Einen Weg hat der EuGH selbst aufgezeigt: Es spricht wohl nichts dagegen, die HOAI als „Orientierungs- oder Bezugsrahmen“ anzuwenden. Die Bieter könnten darauf Zu- oder Abschläge anbieten. Damit würde man sich in einem bewährten Rahmen bewegen, ohne die starren Preisbildungsmechanismen bzw. Preisgrenzen anzuwenden.
Blick in die Zukunft
Letztlich wird abzuwarten sein, welche rechtliche Folgelösung gefunden wird. Die Architektenkammern, die offensichtlich bereits mit einer entsprechenden Entscheidung gerechnet haben, wollen nach eigenen Angaben mit der Bundesregierung sprechen und streben an, dass die HOAI im Kern erhalten bleibt und die bisherigen Vergütungsregelungen zumindest als Bezugsgröße dienen sollen.
Laut Bundesarchitektenkammer gab es zu Beginn dieses Jahres in Deutschland rund 138.000 Architekten und Stadtplaner. Davon waren nahezu 57.000 freischaffende Berufsangehörige. Dementsprechend ist gerade in den aktuellen Zeiten der florierenden Bautätigkeit der Handlungsdruck entsprechend groß.
Verwandte Beiträge
Bildquelle: nmann77 – shutterstock.com
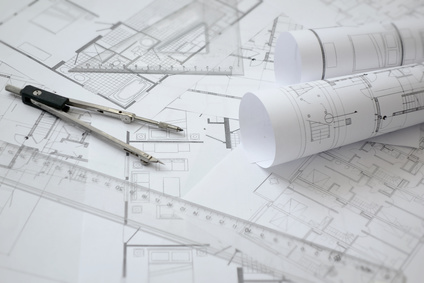

Sehr geehrte Damen und Herren,
das EUGH-Urteil bez. der HOAI bezieht sich im Wesentlichen darauf, dass die gesetzliche Vorgabe von Mindest- und Höchstsätzen für unzulässig erklärt wurde.
Dennoch gilt für öffentliche Auftraggeber bezüglich der Ausschreibung von Planungsleistungen über dem Schwellenwert die VgV. Diese wurde ja vom EUGH nicht beanstandet.
Gem. VgV § 76 Abs. 1 werden Architekten- und Ingenieurleistungen im „Leistungswettbewerb“ vergeben, und nicht im „Preiswettbewerb“.
Ein verschärfter „Preiswettbewerb“ dürfte deshalb auch weiterhin gemäß VgV nicht erwünscht sein.
Um nach wie vor die weiteren für öffentliche Auftraggeber geltenden Vorschriften (VgV und RBBau) einhalten zu können, empfiehlt es sich für öffentliche Auftraggeber gem. VgV §58 Abs. 2 Festpreise bzw. Festkosten gem. den Sätzen der HOAI im Ausschreibungsverfahren vorzugeben, so dass der Wettbewerb – wie bisher auch – überwiegend in Bezug auf die Leistung geführt wird (wie gem. VgV §76 gefordert).
Diese Vorgehensweise wird auch von den Architektenkammern empfohlen.
Das Urteil ist deshalb eher für den privaten Sektor als für den öffentlichen Sektor von Belang.
Für die Architekten und Ingenieure hat das EUGH-Urteil nur einen einzigen Nachteil:
Einmal schriftlich vereinbarte Honorare, die ggfs. unter dem Mindestsatz liegen, können im Nachhinein nicht mehr mit Verweis auf die Gesetzmäßigkeit der HOAI per Gerichtsstreit nach oben korrigiert werden.
Ebenso gilt für Bauherren (hier insbesondere für private Bauherren):
Wurde schriftlich ein Honorar vereinbart, welches die Höchstsätze massiv überschreitet, dann kann dies nicht mehr mit Verweis auf die Gesetzmäßigkeit der HOAI im Nachgang gemindert werden.
Da öffentlichen Auftraggebern meistens über die Zuwendungsbescheide bereits vorgegeben wird, dass sie mit den Mindestsätzen der HOAI auskommen müssen, ist es öffentlichen Auftraggebern anzuraten, gem. VgV §58 die Mindestsätze der HOAI für die Grundleistungen weiterhin im Vergabeverfahren vorzugeben.
Wir bereits erwähnt, ist deshalb vom EUGH-Urteil eher die Privatwirtschaft betroffen.
Ich würde deshalb empfehlen, dass Sie Ihren Artikel zum EUGH-Urteil nicht unter dem Sektor „Öffentliche Beschaffung“ einstellen.
Mit freundlichen Grüßen
Sehr geehrte Frau Wiedenmann-Stahl,
vorab einen herzlichen Dank für die differenzierte Betrachtung.
Der angeführte § 58 Abs. 2 Satz 3 beschreibt nach unserer Einschätzung nicht den Regel-, sondern eher den Ausnahmefall. Ob die regelmäßige Vorgabe eines Festpreises bei Planungsleistungen im Sinne des EuGH oder der Sache ist, können wir nicht beurteilen. Uns scheint es mehr eine Entscheidung im Einzelfall zu sein, wie immer bei der Auswahl der Wertungsmethoden und -kriterien.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Redaktions-Team der cosinex